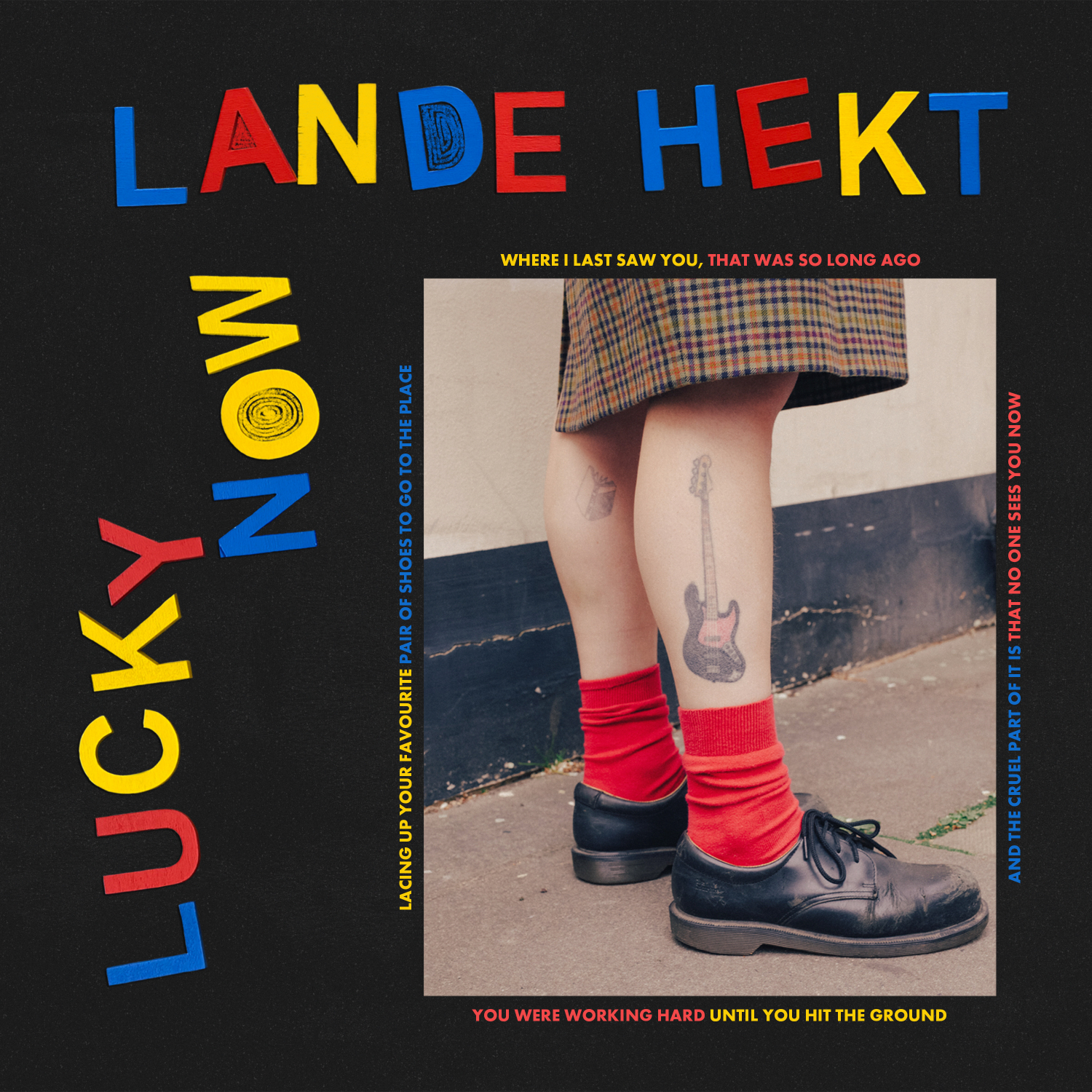Groß, größer
Man muss die Phrase „Hat sich selbst übertroffen“ bemühen: Neil Hannon hat als The Divine Comedy seinem ohnedies erlesenen Œuvre ein extra schönes Album hinzugefügt.

The Divine Comedy: Rainy Sunday Afternoon (Divine Comedy Records)
Es war in den früheren 90er Jahren; die englische Musikpresse hatte gerade einen unsympathischen Hype um Britpop angefacht. Die Pop- und Rockszene des insulären Königreichs folgte ihr nur zu bereitwillig, sich an sich selbst zu berauschen. Dazu brauchte es nicht viel – Schlichtheit und gegebenenfalls, um auch die Boulevardpresse zu unterhalten, ein bisschen Raubeinigkeit und von schlechtem Geschmack zeugende Großmäuligkeit (Oasis).
Und in diese Szene platzte ein dandyhaft aufgemachter Akteur aus Nordirland, der mit großer Geste – die ihre künstlerische Entsprechung in theatralischem Kammer-Pop, orchestraler Üppigkeit und nachgerade ostentativ zur Schau gestellter Bildungsbeflissenheit in den Inhalten fand – solche Selbstgenügsamkeit als das kenntlich machte, was sie definitiv war, nämlich armselig.
Naturgemäß wurde das damals nicht flächendeckend goutiert. Heute ist Neil Hannon, der unter dem kulturgeschichtsschweren Moniker The Divine Comedy agiert, gemeinhin anerkannt und immer noch erstaunlich erfolgreich: Die letzten DC-Alben „Foreverland“ (2016) und „Office Politics“ (2019) schafften es beide in die Top Ten der britischen Charts. Überdies reüssierte Hannon mit Musik zu Paul Kings Kino-Hit „Wonka“.
Aufreger ist er, der demnächst (7. November) 55 wird, längst nicht mehr. Man weiß und schätzt, was man an ihm hat.
The Divine Comedy, die nur in einer kurzen Rock-Phase um die LP „Regeneration“ Anfang der Nuller-Jahre eine richtige Band war und sonst einfach Erfüllungsorgan und Live-Vehikel für den Sänger, Multiinstrumentalisten, Songschreiber und Produzenten Neil Hannon, ist selbstverständlicher Teil eines distinguierten musikalischen Establishments, der verlässlich liefert.
Um unter diesen Prämissen noch Aufsehen zu genieren, muss Hannon sich selbst übertreffen. Und ungefähr das ist ihm mit dem neuen Divine Comedy-Album „Rainy Sunday Afternoon“ gelungen.
Sterblichkeit, Politik und sporadisch erfreulichere Geschichten
Neil Hannon hat sich über seine mehr als drei Karriere-Dekaden hindurch nicht immer nur als Dandy präsentiert. Zwischendurch gab er, langmähnig und in Jeans-Kluft, den Working Class Hero (ironisch hat sich Hannon einmal als „Guardian-lesenden Champagner-Sozialisten“ bezeichnet), den Intellektuellen, Napoleon und natürlich den klassischen Bohemien.
Bei „Rainy Sunday Afternoon“ wird er nun als soziales Wesen vorstellig – dein und mein Nachbar, der aufmerksam die Vorgänge um sich herum beobachtet. Erstmals auf einem DC-Cover zeigt er sich von Menschen umgeben – „normalen“, unglamourösen Menschen; seine leicht defensive Haltung, sein Blick lassen Sorge und Skepsis erahnen, was angesichts der Weltlage nicht übertrieben verwundert.

Ein älterer Gentleman mit etwas skeptischem Blick auf die Welt: Neil Hannon (© Kevin Westenberg)
Sterblichkeit, die globale Politik und die Gestalten, die gegenwärtig ihren Lauf bestimmen, Verschwörungserzählungen, Erinnerungen und, gerne philosophisch-parabelhaft kontextualisiert, Geschichten um Beziehungen bilden in etwa den inhaltlichen Rahmen der Platte. Als musikalischen Trost gönnt man sich dann schon gern einmal üppige Orchester-Arrangements.
Im eröffnenden „Achilles“ nimmt Hannon Anleihen bei der englischen Lyrik, wie er es schon in „Lucy“ auf dem DC-Durchsbruchsalbum „Liberation“ (1993) getan hat. Diesfalls ist seine Quelle das Gedicht „Achilles In The Trench“, das der Poet, Gelehrte und Banker Patrick Shaw-Stewart (1888 – 1917) im Ersten Weltkrieg geschrieben hat, als er auf dem Gelände, wo in der Antike die Stadt Troja gelegen haben (und der sagenhafte griechische Held Achill gestorben sein) soll, auf den Transport zu einem Fronteinsatz wartete*.
Der Refrain zitiert Shaw-Stewart wörtlich: „Was it so hard to die, Achilles / So very hard to die? / You know and I know not, Achilles / So much the happier I“.
Gedanken an die eigene Hinfälligkeit folgen, dick eingemummt in schmelzenden Pop-Belcanto und symphonische Watte, den ziemlich schaurigen Bezügen auf die erste Menschheitskatastrophe des 20. Jahrhunderts.
Im getragenen, ebenfalls von Vergänglichkeit gezeichneten „The Last Time I Saw The Old Man“ bekommen die Streicher – leider nur relativ kurz – Gesellschaft von einem ergreifend melancholischen Flügelhorn.
Entfernte Ähnlichkeit mit einem Bänkellied hat das lustig-absurde „The Man Who Turned Into A Chair“, während der einsichtsvolle Titelsong – der Protagonist räumt ein, dass ein dummer Streit mit seiner Partnerin seinem Verschulden zuzuschreiben ist – als gemütlich schunkelnder Swing Entspannung indiziert.
Das langsam-besinnliche „I Want You“ ist eines dieser Liebeslieder mit Hintersinn, denn während der Protagonist beteuert, nichts anderes zu wollen als „you“, lässt er am Ende die Enttäuschung spüren, wenn Menschen viel Aufwand betrieben haben, um ihre Helden zu treffen und feststellen müssen, wie gewöhnlich sie eigentlich sind. Weihnachtsstimmung kommt in „All The Pretty Lights“ auf, das auf bezaubernde Weise das Kind im Manne wiedererweckt.
Das Ende: Ein Erlösungstraum
Knapp nach Halbzeit folgt ein „politischer“ Teil: „Down The Rabbit Hole“, das so etwas Ähnliches wie Zirkusmusik mit offensiven Gitarren kontrastiert, beschäftigt sich auf gallige Weise mit Verschwörungsphantasten und ihren Echokammern, während das passenderweise Tropen-Feeling verströmende „Mar-a-Lago by The Sea“, betitelt natürlich nach dem Golf-Domizil des US-Präsidenten Donald Trump in Florida, nichts an Giftigkeit vermissen lässt: „Cheating losers on the greens / Swapping wives for beauty queens / Making turgid wedding speeches / Entertaining fascist leeches / Mar-a-Lago, how I miss / The golden johns in which I pissed.“
Am Ende steht, wie es bei so großen, universellen Kunstwerken – wir nennen sowas gerne „Wundertüte“ – schöner Brauch zu sein pflegt, ein majestätisch gleitender Erlösungstraum: „And when the time is right we go / Spread our little wings and fly“.
* Patrick Shaw-Stewart starb am 30. Dezember 1917 in Cambrai, Frankreich, durch einen Granatsplitter

The Divine Comedy: Rainy Sunday Afternoon (Divine Comedy Records)
Als Trost für den unerquicklichen Zustand der Welt gönnt man sich gerne einmal üppige Orchester-Arrangements.