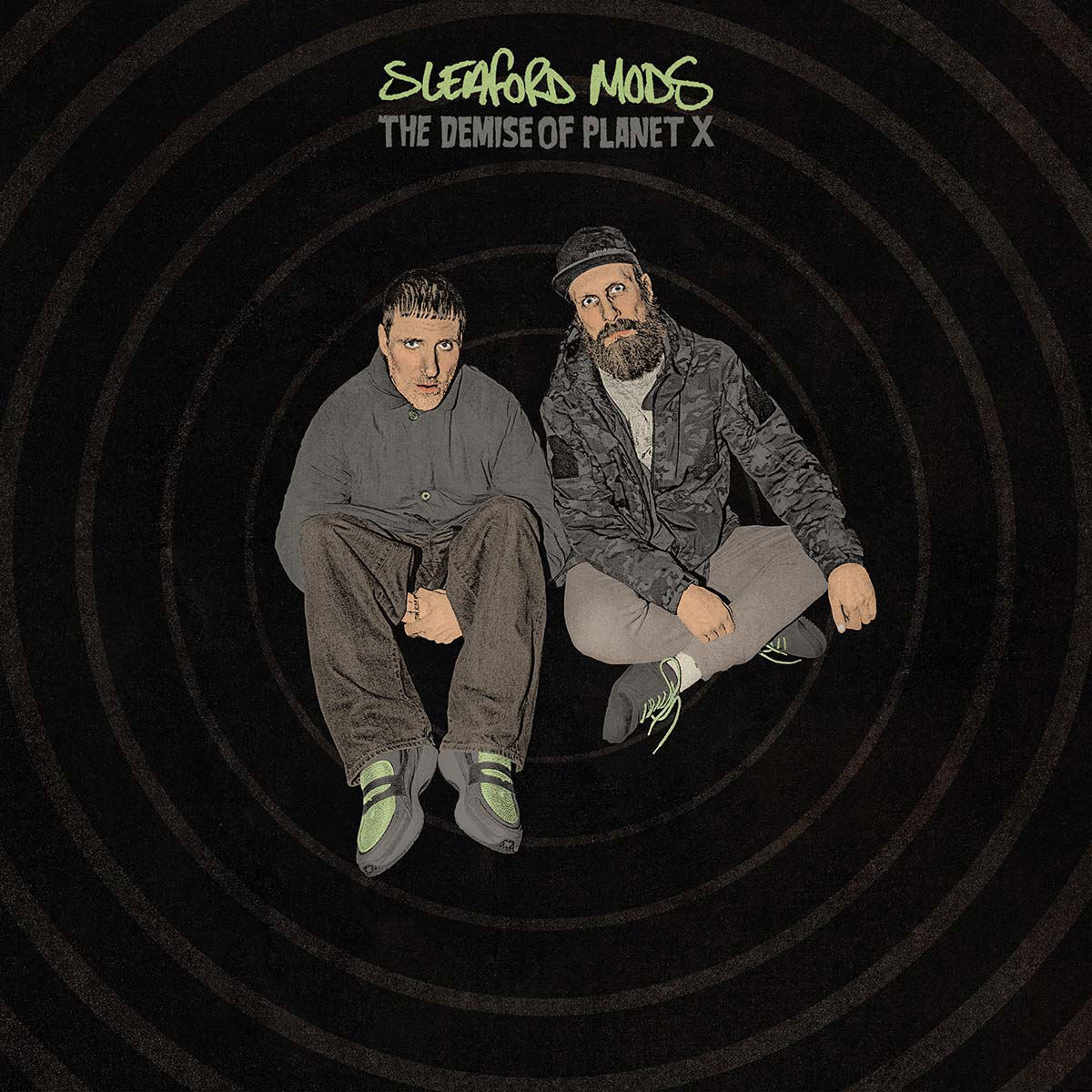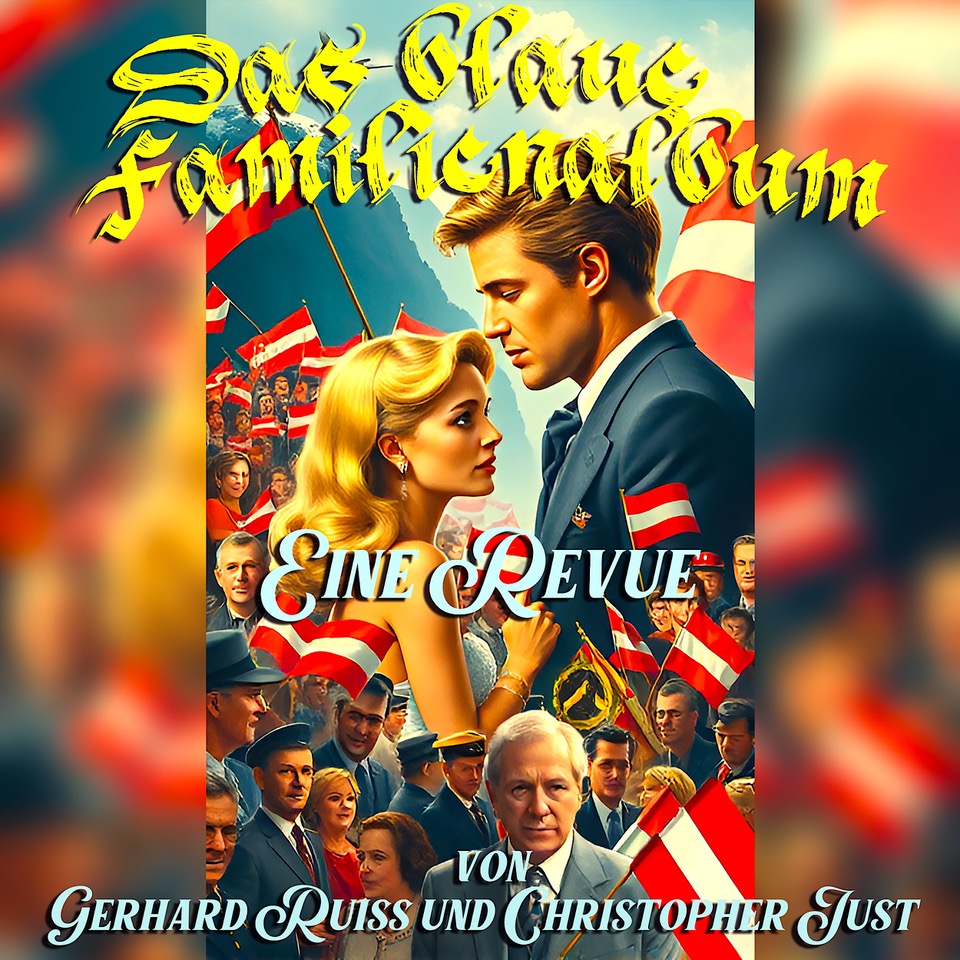Totenklage mit Angeberei
Aus England importiert, hat sich „St. James Infirmary“ seit dem frühen 20. Jahrhundert zu einem Standard der amerikanischen Folklore entwickelt. Bis heute spielen Musiker die Geschichte vom Mann, der seine verstorbene Frau betrauert und dabei in befremdliche Anmaßungen verfällt, in unterschiedlichen Versionen nach.

Von „Dr. House" Hugh Laurie stammt eine der schönsten und gefühlvollsten Versionen von „St. James Infirmary“
Wie man weiß, verdanken die USA eine ihre bedeutendsten Kulturleistungen, nämlich die Populärmusik, afrikanischen und europäischen Quellen: dem Blues als der Musik von Schwarzafrikanern, die als Sklaven eingeschleppt und ausgebeutet worden waren, und dem Folk, der im Marschgepäck europäischer, insbesondere englischer und irischer Immigranten ins Land gekommen war.
Eines der bedeutendsten amerikanischen Volkslieder, „St. James Infirmary“, vereint beide Quellen: Einerseits basiert es auf einem britischen Folksong des 18. Jahrhunderts, andererseits transportiert es in seiner Mollstimmung ein tiefes Blues-Feeling (wiewohl es kein „stubenreiner“ Blues ist).
Wie andere Traditionals – etwa das artverwandte „Streets of Laredo“ – ist „St. James Infirmary“ eine Reihe von Transformationen durchgegangen. Seine Geschichte ist auf Wikipedia sowohl auf der deutschen wie auch der englischen Seite gut dokumentiert und wird daher hier gerafft wiedergegeben.
Der Titel „St James Infirmary“ bezeichnet ein Spital mutmaßlich in Großbritannien. Wikipedia stellt in den Raum, dass es sich um das St. James Hospital in London handeln könnte, eine religiöse Stiftung, in der Leprakranke behandelt wurden.

„Under Cover“ (Cartoon: Margit Krammer)
Ein Umstand allerdings, der Zweifel an dieser Deutung ausgelöst hat, ist die zeitliche Divergenz zwischen der Betriebszeit des bereits 1532 geschlossenen Krankenhauses und den vermuteten Ursprüngen des Lieds im 18. Jahrhundert.
Wahlweise als „The Unfortunate Rake“ oder „The Unfortunate Lad“ bekannt, handelt diese potentielle Urfassung von einem Soldaten, der sich bei einer Prostituierten mit einer Geschlechtskrankheit ansteckt und daran stirbt.
Inhaltliche Metamorphose in Amerika
Nach seiner Migration über den Großen Teich vollzog der Song eine inhaltliche Metamorphose: Spielsucht und Alkoholismus sind nunmehr die Vehikel des Unheils; die sterbende Person ist eine Frau.
Im „Gambler´s Blues“, als dessen Urheber die Singer-Songwriter Carl Moore (1902-1985) und Phil Baxter (1896-1972) verantwortlich zeichnen, ist das heute bekannte Stück bereits in vielen Determinanten zu erkennen. 1927 wurde es vom Jazz-Musiker Fess Williams und seiner Band (ohne Angabe des Sängers) auf Platte aufgenommen.
1928 veröffentlichte Louis Armstrong eine melodiös praktisch idente, textlich etwas verkürzte Version, eröffnete indessen dem Stück mit seinem elegischen, temperierten Trompetenspiel und gefühlvollen Gesang musikalisch eine neue Dimension. Allerdings trug Armstrongs Fassung den Titel „St. James Infirmary“. Als ihr Autor ist der Komponist, Bandleader, Arrangeur, Saxophonist und Klarinettist Don Redman ausgewiesen.
Ein Jahr später sicherte sich der Verleger, Musiker und Jazz-Promoter Irving Mills die Rechte an dem Lied, das mittlerweile viele große Jazz-Musiker – etwa King Oliver, Cab Calloway oder Artie Shaw – erfolgreich im Repertoire hatten und auf Platte aufnahmen.
Obwohl der Song gerichtlich als öffentliches Eigentum bewertet wurde und somit eigentlich copyrightfrei war, profitierte Mills noch Jahrzehnte von den Tantiemen. Mills argumentierte, er habe zwar nicht das Stück kreiert, aber die Rechte am Titel „St. James Infirmary“ erworben und viel Arbeit und Geld in dessen Verbreitung und Vermarktung gesteckt.
Da außerdem bekannt war, dass es ihm an Aggressivität, Ausdauer und tiefen Taschen für längere Verfahren nicht mangelte, scheuten viele potentielle Kontrahenten eine gerichtliche Konfrontation.
Viele Versionen – auch eine wienerische
„St. James Infirmary“ überlebte alle Geschmackswandlungen und wird bis heute gerne nachgespielt. Es gibt allein unter namhaften* Interpret/innen hunderte Versionen. Josh White, Kid Ory’s Creole Jazz Band, Dave Van Ronk, Lou Rawls, Eric Burdon & The Animals, Jerry Reed, Joe Cocker, Roger McGuinn, The Triffids, Mark Lanegan, Arlo Guthrie, Wynton Marsalis, Eric Clapton & Dr. John, The White Stripes, Joe Dassin, Bobbie Bland, Janis Joplin, der kürzlich verstorbene Klaus Doldinger (mit Helge Schneider an der Orgel), Rickie Lee Jones und viele andere haben sich daran abgearbeitet. The Doors pflegten es gerne in Medleys, etwa mit „Love Me Two Times“ und „Baby Please Don´t Go“, einzustreuen. Es gibt auch eine wienerische Version durch Ernst Molden, ihr Titel und Schauplatz ist die „Rudolfstiftung“.
Vom Text existieren ungefähr 20 Varianten; grosso modo folgen die Versionen aber zwei Hauptsträngen: Der eine orientiert sich an Louis Armstrong und steigt direkt mit dem Erzähler ein, der seine Frau/Freundin/Lebensgefährtin im Spital tot auf einem großen weißen Tisch vorfindet.
Der andere Strang erinnert an die Vorgeschichte des Songs als „Gambler´s Blues“ und beginnt und endet mit einer Rahmenhandlung in einer Bar. In diese kommt ein Mann, der meistens den Namen „Joe McKinney“ (bei Molden „Nemeskal Michi“) trägt, mit vom Weinen blutunterlaufenenen Augen zu erzählen beginnt, wie er eben seine Liebste tot im Spital gesehen hat, und danach noch einen Drink ordert.
Was beide Versionen gemein haben, ist ein irritierender, ja geradezu befremdender Twist im Narrativ: Der Mann, der eben noch tief trauerte, ist sich sicher, dass die Verstorbene, „wherever she may be„, nie und nirgends „a sweet man like me“ finden werde. „Bragging!“ (Angeberei) kommentiert in Armstrongs frühester Version eine amüsierte Stimme (eher nicht des Sängers) diese Ansage.
Ohne Umschweife schwenkt der Protagonist dann zu Instruktionen für sein eigenes Begräbnis. Und da darf nicht gekleckert werden. Schuhe mit gerader Verschnürung und ein schwarzer Mantel sollen ihm angezogen werden, ein Stetson-Hut aufgesetzt und eine 20-Dollar Gold-Münze auf die Uhrkette gelegt werden (was klar macht, dass der Verstorbene niemandem Geld schuldete).
Zusätzlich Instruktionen fordern einen Leichenzug mit 16 schwarzen Pferden, sechs Sargträgern, sieben Frauen, von denen nur sechs zurückkommen, eine Sängerin, die ein Lied singt, und eine Jazz-Band, die beim Leichenzug ordentlich Wirbel macht.
Keine (bekannten) schwulen Versionen
Die überwältigende Mehrzahl der Versionen ist von Männern. Das ist keineswegs zwingend notwendig, denn es würde die innere Logik und den heteronormativen Kontext des Narrativs in keiner Weise beeinträchtigen, würden die Geschlechter der Hauptpersonen einfach umgedreht (Mann tot, Frau räsonniert).
Cassandra Wilson tut das in ihrer Version auch, wobei sie einen besonderen inhaltlichen Kunstgriff anwendet, indem bei ihr die hinterbliebene Frau die im ursprünglichen Text noch fiktiven Begräbniswünsche des Mannes bei dessen nun realer Bestattung tatsächlich verwirklichen lässt.
Üblicherweise aber behalten Frauen, wenn sie wie Janis Joplin (in einer frühen Fassung von 1962) oder Rickie Lee Jones „St. James Infirmary“ covern, die originale Geschlechtszuschreibung bei.
Anders als etwa bei Dolly Partons Klassiker „Jolene“, wo in der Version der White Stripes Jack White die attraktive Titelheldin anfleht, nicht seinen Mann zu verführen, sind bei „St. James Infirmary“ keine Versionen mit einer anderen denn heteronormativen Konnotation gespielt worden (oder haben zumindest keine größere Bekanntheit erlangt).
Eine bedingte Ausnahme von dieser Gepflogenheit gestattete sich indes – jedenfalls in formaler Hinsicht – die Schauspielerin und Komikerin Lily Tomlin 1975 bei einem Auftritt in der Show „Saturday Night Live“, indem sie den Song in Begleitung des heute mehrfach Oscar-prämierten Komponisten und Orchesterleiters Howard Shore und seiner aus Männern in Drag bestehenden All Nurse Band zu einer Klagesatire einer verlassenen Frau umfunktioniert. Die Ironie des Unterfangens hat insofern einen doppelten Boden, als Tomlin seit jeher bekennende Unterstützerin der LGBTQ+-Gemeinschaft war und ist.
Einige Variationen im Vortrag von „St. James Infirmary“ beziehen sich direkt auf die ausführenden Musiker. In einem Live-Duett von Dr. John und Eric Clapton im New Yorker Roseland Ballroom aus dem Jahr 1996 werden der Sterbenden von Dr. John Wünsche für den letzten Weg in den Mund gelegt. Deren ultimativer: „I wanna hear Eric Clapton play the lowdown, gut bucket blues“*. Clapton zeigt bei dieser Passage keinerlei Reaktion, geschweige denn ein Lächeln.
Der franko-amerikanische Chansonnier und Pop-Sänger Joe Dassin schließt seine Version, die wie etliche andere unter dem Titel „St. James Infirmary Blues“ firmiert, mit einer gleichermaßen lustigen wie frechen wie im Endeffekt auch traurigen Wendung ab: „Now, if anybody should ask you who’s been singing this / If anybody should wanna know who wrote this song / Just tell him Big Joe was here this morning / He was here this morning, yeah, but now he’s gone“.
Gerne werden im Übrigen auch Teile des Songs zeichenhaft paraphrasiert. Die aus Newcastle stammende Band Geordie – mit dem späteren AC/DC-Frontman Brian Johnson als Sänger – verwendete Segmente daraus im Hardrock-Song „Goin‘ Down“ – wohl als eine Art sinistres Symbol für ein Szenario, das die ungleiche Wohlstandsverteilung anprangert. Obwohl sich die textlichen und musikalischen Ähnlichkeiten mit „St. James Infirmary“ in einem recht überschaubaren Rahmen halten, zeichnen Geordie das Stück als „Traditional“.
Viel prominente Unterstützung für den zynischen Fernsehdoktor
Eine echte – und grandiose – Überraschung ist indes, dass unter den originalgetreuen Versionen eine der besten und gefühlvollsten neben der des unvergessenen David McComb und seiner Triffids von Hugh Laurie stammt. Jawohl, dem Darsteller des zynischen „Dr. House“ aus der gleichnamigen Fernsehserie.
Im März 2011 trat Laurie als Sänger, Pianist und Gitarrist in einem Club in New Orleans auf, um Blues-Standards aus der Stadt – darunter und zuallererst, nämlich am Anfang, eben auch „St. James Infirmary“ – zum Besten zu geben. Begleitet wurde er dabei von einem Bläser-Ensemble unter der Leitung des großen Komponisten und Produzenten Allen Toussaint. Wenig später ging er mit dem Material auf Tour; schon vorher war es im Studio aufgenommen worden. Im April 2011 wurde es mit dem Titel „Let Them Talk“ auf CD veröffentlicht.
Laurie konnte sich bei den Aufnahmen prominenter Unterstützung versichern: Neben Toussaint († 2015) griffen ihm etwa Irma Thomas, Tom Jones und Dr. John unter die Arme; der große Singer-Songwriter Joe Henry hat das Werk produziert.
„Let Them Talk“ wurde nicht nur ein Erfolg bei der Kritik, sondern auch beim Publikum: Im UK war es 2011 das bestverkaufte Blues-Album.
* „Namhaft“ im Sinne von Reputation und/oder Breitenwirkung
** „Gut Bucket Blues“ ist ein Song von Louis Armstrong aus 1956, steht aber auch für eine raue, rhythmisch betonte, ursprünglich aus dem Jazz kommende Variante des Blues.

Von „Dr. House" Hugh Laurie stammt eine der schönsten und gefühlvollsten Versionen von „St. James Infirmary“
Obwohl inhaltlich nicht zwingend notwendig, ist die überwältigende Mehrheit der Versionen von Männern.